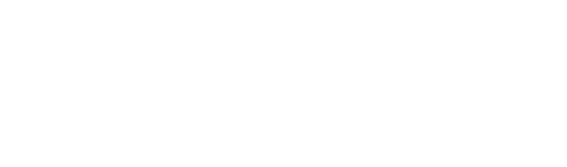Beim diesjährigen Leipziger Dokumentarfilmfestival berichtet unser Kollege Kay Hoffmann wieder von seinen Dokumentarfilm-Sichtungen auf den Leinwänden der sächsischen Metropole. In dieser Folge schildert er seine Beobachtungen zu »Architektur der Unendlichkeit«, »Charleroi, the Land of 60 Mountains«, »Chris the Swiss« und »Stress«.
Auf eine sehr persönlich philosophische Reise begibt sich der Schweizer Filmemacher Christoph Schaub in »Architektur der Unendlichkeit«. Im Zentrum seines Filmes stehen moderne sakrale und Museumsbauten verschiedener Architekten aus Europa. Die sakralen Bauten spielen für die Menschen eine wichtige Rolle zur Besinnung, über sich selbst und die Unendlichkeit zu reflektieren. Zum Teil sind sie allerdings in ihrer Monumentalität schon erschlagend. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man ihre filigrane Struktur oder die gelungene Verbindung von alt und neu. Dies trifft beispielsweise zu für eine Privatkapelle in Deutschland, die von außen wie ein Silo in der Landschaft steht. Aber zum einen ist die Fassade mit Löchern und Glaskörpern durchlöchert und zum anderen ist innen eine spannende Struktur entstanden. Das Dach oben ist offen, das heißt die Kapelle der Witterung ausgeliefert.
Um Architektur und Stadtplanung geht es im belgischen Film »Charleroi, the Land of 60 Mountains« von Guy-Marc Hinant. Er porträtiert dieses ehemalige Zentrum der Schwerindustrie von Kohle und Stahl und seine Bewohner. Wie das Ruhrgebiet wurde diese Stadt vom Strukturwandel erfasst und muss sich eine neue Identität suchen. Dies ist nicht einfach, denn zu sehr ist sie neben vereinzelten Altbauten von Bausünden der verschiedenen Jahrzehnte geprägt. Der Regisseur versucht ein komplexes Porträt von Charleroi zu zeichnen und setzt dabei poetische und experimentelle Stilmittel ein. Eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt, die es ihm nicht einfach macht, seinen Charme zu entdecken.
Das Leipziger Programm dieses Jahres ist geprägt von Folgen kriegerischer Konflikte und daraus resultierenden Traumata. Es gibt gleich mehrere Produktionen zum ehemaligen Jugoslawien, dem schmerzhaften Prozess der Trennung und dem Erstarken des Nationalismus. In diesem Zusammenhang gehört »Chris the Swiss« von Anja Kofmel zu den herausragenden Produktionen. Der junge Schweizer Journalist Christian Würtenberg ging 1992 nach Kroatien, um für ein alternatives Radio in der Schweiz über den Bürgerkrieg zu berichten. Dort starb er unter rätselhaften Umständen. Die Regisseurin ist seine Cousine und begibt sich auf Spurensuche, was dort passiert ist und warum er sterben musste. Dabei deckt sie die Hintergründe auf und identifiziert seine wahrscheinlichen Mörder. Denn in Kroatien wechselt er die Rolle und schließt sich einem Söldnerheer an. Da er darüber ein Buch schreiben will, wird er eine Gefahr für seine Mitkämpfer, die ihn wohl deshalb erwürgen.
Erzählt wird diese Geschichte mit viel Archivmaterial – es überrascht immer wieder, wovon die Menschen Filme drehen – und vor allem eine beeindruckenden Animation, die von der Regisseurin selbst entwickelt wurde. Sie ermöglicht die gefährlichen Situationen im Krieg sehr direkt mitzuerleben. Anja Kofmel musste für ihren ersten langen Film lange kämpfen, hat dies aber auch mit viel Energie und Durchsetzungsvermögen geschafft. Neben dschoint ventschr aus Zürich und Ma.ja.de in Leipzig gab es mit Nukleus Film einen kroatischen Koproduzenten, der inzwischen politisch viel Druck bekommt. Das zeigt, wie aktuell die Konflikte noch sind. Der Film ist ein herausragendes Beispiel, wie stark dokumentarisches Material und Animation zusammen wirken können.
Mit den Traumata amerikanischer Soldatinnen und Soldaten setzt sich der Deutsche Florian Baron in »Stress« auseinander. Er wählt dafür eine innovative Form, in dem er die Statements seiner fünf Protagonisten mit visuell überhöhten Bildern unterlegt. Dabei setzt sein Kameramann Johannes Waltermann zum Beispiel eine Highspeed Kamera ein. Damit haben sie aus einem Auto heraus den Alltag auf den Straßen von Pittsburgh aufgenommen. Auf der Leinwand bewegt sich die Kamera scheinbar in normaler Geschwindigkeit, die Personen agieren allerdings in extremer Slow-Motion. Deis ist die visuelle Umsetzung, dass sich für die Protagonisten durch ihre Einsätze und das Durchleben von Bombenangriffen das Leben geändert hat und sie es anders wahrnehmen. Denn sie müssen nach einem fremdbestimmten Leben beim Militär erst wieder lernen, ihr Leben selbst zu organisieren. Dass gelingt nicht allen. Einer igelt sich in seiner Wohnung ein, ein anderer begeht Selbstmord. Täglich gibt es in den USA 22 Selbstmorde von Veteranen. Ein hoher Preis dafür, eine militärisch überall präsente Weltmacht zu sein. Sehr genau schildern sie ihre Erlebnisse und Gefühle dabei. Ein Protokoll des Leidens und der Hilflosigkeit. Umso erstaunlicher, dass sie sich nicht wehren würden, wenn ihre Kinder auch eine Militärkarriere anstreben würden. Das Militär wäre immer noch die eigentliche Schule der Nation. Es erschüttert, dass sie aus ihren Fehlern nichts gelernt haben und ihre eigenen Erfahrungen verdrängen.